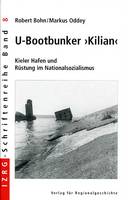IZRG-Schriftenreihe, Band 8
Robert Bohn/Markus Oddey Der Kieler U-Bootbunker "Kilian" Eine kulturhistorische Dokumentation
Inhalt
Vorwort
I. Historischer Teil
Kiel als Standort der deutschen Rüstungsindustrie (1939-1945) unter besonderer Berücksichtigung des U-Bootbunkers ‚Kilian'
Die Quellenlage und ihre Problematik
Forschungslage
1. Die Entwicklung Kiels als Rüstungsstandort bis 1939
Die Marine in Kiel
Ausbau der Stadt Kiel zum Reichskriegshafen
Handelshafen oder Reichskriegshafen
Kieler Hafenwirtschaft in der Weimarer Republik
Der Schiffbau
Handel und Verkehr
Arbeitslosigkeit und soziales Elend in Kiel
Der Kieler Hafen im Nationalspzialismus
Zusammenfassung: Der Kieler Hafen im Spannungsfeld zwischen zivilwirtschaftlicher und kriegswirtschaftlicher Nutzung vor 1939
2. Kriegsschauplatz Kieler Hafen
Die Entwicklung des Luftkriegs über dem Kieler Hafen
Das erste Kriegsjahr
"Bomber Harris" und Flächenbombardements
"Casablancadirektive" und "erste ernstzunehmende Schäden"
Invasion und Sommeroffensiven 1944
Bis zur totalen Zerstörung
Reaktionen der Luftschutzstellen in Kiel auf den Luftkrieg
Allgemeine Schutzmaßnahmen für Stadt und Hafen
Spezielle Luftschutzmaßnahmen auf den Werften
Zusammenfassung
3. Die deutschen U-Bootbunker und der ‚Kilian'
Der Seekrieg als Planungsgrundlage für U-Bootrüstung und U-Bootbunkerbau
Vor dem Zweiten Weltkrieg
Der Seekrieg entwickelt sich zum U-Bootkrieg
Verluste der deutschen U-Bootflotte und Versuche der Gegensteuerung
Die Planungen für den Bau von U-Bootbunkern auf deutschen Werften
Deutscher U-Bootbunkerbau im Ersten Weltkrieg
U-Bootbunker an der französischen Atlantikküste
Die U-Bootbunker im Reich
Die Bauvorbereitungen
Bereitstellung von Baumaterialien und Baugeräten
Bereitstellung von Arbeitskräften
Exkurs: Der U-Bootbunker ‚Valentin'
Fremdarbeiter auf den Kieler Werften und beim Bau des Kilian
Die Baudurchführung
Die Bunkergründung
Betonierungsarbeiten
Deckenkonstruktionen
Der Innebausbau
Ungelöste Probleme beim Bunkerbau
Die Bunkernutzung
Reparaturen und Ausrüstungsarbeiten
Produktion von neuen U-Boottypen
Weitere U-Bootbunkerbauprojekte im Kieler Hafen
Exkurs: Die Kleinkampfmittel
Verbunkerung und Fliegerangriffe
Luftangriffe auf die U-Bootbunker
Entwicklung der Fertigungszahlen
Schutz für die Belegschaften der Werften
Zusammenfassung
4. Epilog: Besatzungszeit und Demontagepolitik
Sprengung des Kilian und Diskussion der Richtlinien für die Demontagepolitik
Rolle der Kieler Stadtvertretung in der Demontagepolitik
II. Zeitgenössischer Teil
Der Meinungsstreit um die Nutzung der Bunkerruine ‚Kilian'
1. Bunker und Bunkergelände in der Nachkriegszeit - eine Chronologie
Vor 1959: Besitzwechsel von der Kriegsmarine über die Besatzungsmacht in Bundesbesitz
1959: Zweiter Versuch der Bunkersprengung
Bis 1980: Fehlende Wahrnehmung des Kilian
1981-1987: Erste Planungen zur Erweiterung des Ostuferhafengeländes
1987-1992: Ist der Bunker Kilian ein Denkmal von besonderem kulturellen Wert?
1992-1996: Ist eine Hafenerweiterung unter Erhaltung der Ruine möglich und wirtschaftlich sinnvoll?
1997-2000: Politische Entscheidung für den Abriss nach Abwägen denkmalrechtlicher und wirtschaftlicher Belange
2. Der Streit um den Denkmalwert der Bunkerruinen
Die Ruinen des U-Bootbunkers Kilian als ein ‚Denkmal von besonderer kultureller Bedeutung'
Verändertes Verständnis von Denkmalschutz und nationalsozialistischer Vergangenheitsbewältigung
Der Denkmalwert des Kilianbunkers im Vergleich zu anderen Mahn- und Denkmalen an die Zeit des Nationalsozialismus im Kieler Stadtgebiet
Geplante und durchgeführte Aktionen zur Förderung des Denkmalwertes
Der Bunker und die Kuns
Die Bunkerruinen als "Betonschrotthaufen der Geschichte"
Das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts
Exkurs: Der Streit um die Sicherheit des Bunkergeländes
3. Der Streit um wirtschaftliche Belange im Rahmen der Hafenerweiterung
Das von den Hafen- und Verkehrsbetrieben in Auftrag gegebene Gutachten - Ableitungen und Kritik
Prognostiziertes Wachstum der Ostseeverkehre
Konkurrenz durch andere Handelshäfen
Ausweichmöglichkeiten auf andere Hafenflächen
Arbeitsplätze
Weitere Kritikpunkte
Die "kleine Lösung" - Hafenerweiterung unter Einbezug der Bunkerflächen
Möglichkeiten einer Minimallösung
4. Politische Abwägung zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Belangen
Die Entscheidung der Landesregierung
Reaktionen auf die Beschlussfassung der Landesregierung
5. Kurze Bewertung der Abrissdebatte um die Ruinen des U-Bootbunkers Kilian
III. Anhang
Quellen
Ungedruckte Quellen
Gedruckte Quellen
Literatur
Wer wir sind und was wir machen
Uwe Danker /Melanie Richter-Oertel: Historischer Lernort Neulandhalle
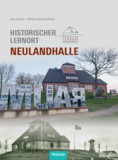
Im Husum-Verlag ist der Katalog zum Historischen Lernort Neulandhalle als "transportable Ausstellung" erschienen. Der Band ist zum Preis von 14,95 € über den Buchhandel (ISBN: 978-3-96717-127-3) oder über den Verlag zu beziehen.
Uwe Danker/Astrid Schwabe: Die Volksgemeinschaft in der Region


Im November 2022 ist das Hand-, Studien- und Lesebuch "Volksgemeinschaft in der Region. Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus" erschienen. Bestellbar ist das Buch über den Buchhandel (ISBN 978-3-96717-007-8) oder direkt über den Husum-Verlag. /// Bericht des Schleswig-Holstein Magazin /// Flensburger Tageblatt /// Taz
Uwe Danker (Hg.): Geteilte Verstrickung: Elitenkontinuitäten in Schleswig-Holstein


Im Husum-Verlag ist die zweite NS-Kontinuitäten-Studie für Schleswig-Holstein im Mai 2021 erschienen. Die beiden Bände sind zum Preis von 59,95 Euro (ISBN-Nummer 978-3-96717-061-0) über den Verlag oder den Buchhandel beziehbar.
Uwe Danker/Astrid Schwabe (Hg.): Die NS-Volksgemeinschaft

In den vergangenen Jahren hat sich in der Geschichtswissenschaft eine produktive Debatte um den Begriff der NS-Volksgemeinschaft entfaltet. Der vorliegende Band vereint Beiträge aus Fachwissenschaft und Geschichtsdidaktik. In den Fokus rücken didaktische Potenziale des Konzepts und seiner Umsetzung in der schulischen sowie außerschulischen Vermittlung der Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust.