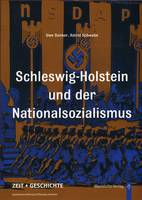Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus
Uwe Danker
und Astrid Schwabe
Neumünster 2005
ISBN 3 529 021810-X
(2. Auflage 2006)
1. Der gescheiterte Versuch. Die Weimarer Demokratie in Schleswig-Holstein (1918-1932)
Claus Heim, ein bäuerlicher Bombenleger
Demokratie ohne Durchsetzungskraft: Die ‚Affäre Schönberg‘
Der ‚Altonaer Blutsonntag‘
2. Der Weg zum neuen Staat. Aufstieg und Machtübernahme der Nationalsozialisten (1918-1934)
2.1 Propaganda, Gewalt und Wahlen: Aufstieg der NSDAP
Hans Fallada: Bauern, Bonzen und Bomben
Tanz und Propaganda in Lensahn
2.2 Gesellschaftlicher und ideologischer Nährboden
‚Die Blutnacht von Wöhrden‘
Markantes aus der Forschung
2.3 Machtübernahme
Zum Umgang mit ‚Politischen Gegner‘: Morde und Hatz bis zur verzweifelten Selbsttötung
Frühe ‚Konzentrationslager‘ in Schleswig-Holstein
2.4. Herrschaftsaufbau und -struktur
Regierungspräsident Anton Wallroth
Hinrich Lohse: NSDAP-Gauleiter und Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein
3. Die neue ‚Volksgemeinschaft‘. Leben zwischen Mitmachen, Anpassung, Dissens und Widerstand (1933-1939/1945)
3.1 NS-Volksgemeinschaft: Integration und Ausgrenzung
Markantes aus der Forschung
Die Dänische Minderheit
Frauen im Nationalsozialismus
Klatsch am Rande einer Beerdigung
Das ‚Café Waldheim‘ in Flensburg-Harislee
Die Fischer von Eckernförde
3.2 Jugend
Alltag in der ‚Hitlerjugend‘
‚Landjahr‘ in Schleswig-Holstein
3.3 Schule
Lehrerbildung
Die ‚Nationalpolitische Erziehungsanstalt‘ Plön
NS-Geschichtsunterricht nach Karl Alnor
3.4 Glaube und Kirche
Bandbreite: Verhaltensweisen Evangelisch-Lutherischer Geistlicher. Die biographischen Beispiele Andersen, Peperkorn, Szymanowski, Halfmann, Asmussen und Hasselmann
Die Lübecker Geistlichen
Heinrich und Tine Bielenberg, zwei ‚Zeugen Jehovas‘
4. ‚Der schöne Schein‘. Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Propaganda (1933-1945)
4.1 Wirtschaft
Statt Klassenkampf und Tarifkonflikten: ‚Betriebsgemeinschaften‘ und die ‚Deutsche Arbeitsfront‘ (DAF)
Der ‚Reichsarbeitsdienst‘ (RAD)
4.2 ‚Landesuniversität‘
‚Kriegsvorlesungen für das deutsche Volk‘
4.3 Kunst und Kultur
Ernst Barlach
Emil Nolde
A. Paul Weber: „Hitler – ein deutsches Verhängnis“
Der ‚Eutiner Dichterkreis‘
4.4 Selbstinszenierung
Ideologisierte Landgewinnung an der Westküste
Der nationalsozialistische ‚Friesenmythos‘
Der ‚Kieler Zeitungsverlag‘
Markantes aus der Forschung
5. ‚Ausmerze der Andersartigen und Gemeinschaftsfremden‘. Überwachung, Gewalt und Verfolgung (1933-1945)
5.1 Holocaust, Behindertenmord und Verfolgung von ‚Asozialen‘ und Homosexuellen
Wilhelm Spiegel
Der Lynch-Mord an Dr. Friedrich Schumm
Die Reichspogromnacht in Schleswig-Holstein
Das Schicksal der Lübecker Familie Prenski
Dr. med. Ernst Bamberger
Markantes aus der Forschung
Zwangssterilisation wegen ‚Angeborenen Schwachsinns‘
‚Kinderfachabteilung‘ Schleswig
5.2 Gewaltstrukturen
Bredstedt 1935: Ein folgenschwerer Bruderzwist
Pinneberg 1944: Von der Denunziation zum Urteil
Landrat Theodor Fründt und Kreisleiter Hans Gewecke in Lauenburg
Staatsanwalt am ‚Sondergericht‘ und ‚Widerstandskämpfer‘: Dr. Paul Thamm
Lager Frøslev
Die ‚Außenkommandos‘ des KZ Neuengamme in Husum-Schwesing und Ladelund
Hans-Hermann Griem: Kommandant der KZ-Außenstellen Schwesing und Ladelund
Das ‚Arbeitserziehungslager Nordmark‘
6. Kampf an der ‚Heimatfront‘ und Dienst im ‚Ostland‘. Der Zweite Weltkrieg (1939-1945)
Markantes aus der Forschung
6.1 Kriegsalltag an der ‚Heimatfront‘
Der Bombenkrieg
Zwangsarbeit
6.2 ‚Reichskommissariat Ostland‘
Ein Schriftverkehr im Judenmord
Drei Blicke auf den Judenmord im ‚Reichskommissariat Ostland‘
6.3 Kriegsende
Josef Katz: Erinnerungen eines Überlenden
Die Selbstbefreiung von Elmshorn
Der Bürgermeister von Meldorf
Die Tragödie der ‚Häftlingsflotte‘ in der Neustädter Bucht
Starker Gegner, spätes Opfer: Dr. Julius Leber
„Manneszucht“ über die Kapitulation hinaus
7. Die Nachgeschichte. Neubeginn, Kontinuitäten und Nachwirkungen (1945-1965)
7.1 Besatzungszeit
‚Displaced Persons‘
Die ‚Stunde der Frauen‘
Kiels Oberbürgermeister Andreas Gayk
Schleswig-Holsteins Erster Ministerpräsident Theodor Steltzer
„Wir wollen loyale Bürger des dänischen Staates werden...“ – die ‚Neudänische Bewegung‘
7.2 Flüchtlinge und Vertriebene
Empfang mit Vorurteilen und Ablehnung: Flüchtlinge und Vertriebene
7.3 ‚Aktuelle Vergangenheit‘
Der Lebensabend des Hinrich Lohse
Markantes aus der Forschung
Das Leben der ‚Asozialen‘ Betty Voss
‚Vergangenheitspolitische‘ Affären in Schleswig-Holstein
8. Fazit
9. Anhang
9.1 Chronologie
9.2 Spezielle Literaturnachweise
9.3 Literaturauswahl
9.4 Sachregister
9.5 Personenregister
9.6 Ortsregister
9.7 Abkürzungen
9.8 Abbildungsnachweis
Wer wir sind und was wir machen
Uwe Danker /Melanie Richter-Oertel: Historischer Lernort Neulandhalle
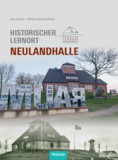
Im Husum-Verlag ist der Katalog zum Historischen Lernort Neulandhalle als "transportable Ausstellung" erschienen. Der Band ist zum Preis von 14,95 € über den Buchhandel (ISBN: 978-3-96717-127-3) oder über den Verlag zu beziehen.
Uwe Danker/Astrid Schwabe: Die Volksgemeinschaft in der Region


Im November 2022 ist das Hand-, Studien- und Lesebuch "Volksgemeinschaft in der Region. Schleswig-Holstein und der Nationalsozialismus" erschienen. Bestellbar ist das Buch über den Buchhandel (ISBN 978-3-96717-007-8) oder direkt über den Husum-Verlag. /// Bericht des Schleswig-Holstein Magazin /// Flensburger Tageblatt /// Taz
Uwe Danker (Hg.): Geteilte Verstrickung: Elitenkontinuitäten in Schleswig-Holstein


Im Husum-Verlag ist die zweite NS-Kontinuitäten-Studie für Schleswig-Holstein im Mai 2021 erschienen. Die beiden Bände sind zum Preis von 59,95 Euro (ISBN-Nummer 978-3-96717-061-0) über den Verlag oder den Buchhandel beziehbar.
Uwe Danker/Astrid Schwabe (Hg.): Die NS-Volksgemeinschaft

In den vergangenen Jahren hat sich in der Geschichtswissenschaft eine produktive Debatte um den Begriff der NS-Volksgemeinschaft entfaltet. Der vorliegende Band vereint Beiträge aus Fachwissenschaft und Geschichtsdidaktik. In den Fokus rücken didaktische Potenziale des Konzepts und seiner Umsetzung in der schulischen sowie außerschulischen Vermittlung der Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust.